"Juli ist ein guter Monat anzufangen"
Interview: Peter Berthold erklärt, warum es sinnvoll ist, Vögel zu füttern - auch im Sommer.
 Herr Berthold, Sie empfehlen in Ihrem Buch "Vögel füttern - aber richtig",
Vögel ganzjährig zu füttern, auch im Sommer. Dabei hört man oft,
zufüttern sei insgesamt eher schädlich.
Herr Berthold, Sie empfehlen in Ihrem Buch "Vögel füttern - aber richtig",
Vögel ganzjährig zu füttern, auch im Sommer. Dabei hört man oft,
zufüttern sei insgesamt eher schädlich.
Das ist schlicht falsch. In England zum Beispiel, der führenden
Nation im Vogelschutz, macht man das seit 30 Jahren mit zunehmendem
Erfolg. Es gibt zahlreiche Studien, die das stützen.
Aber gehen die Vogelbestände nicht gerade in England in den letzten Jahren zurück?
Die Vögel werden insgesamt gesehen überall weniger, und man muss
auch klar sagen, dass man das mit Zufüttern allein nicht verhindern
kann. Der Rückgang lässt sich aber in vielen Fällen abbremsen oder
sogar umkehren. Und das machen die Engländer. In Deutschland hatte man
die Zusammenhänge übrigens auch bereits vor über hundert Jahren richtig
erkannt und entsprechend gefüttert. Doch dann kamen neue, vermeintliche
Experten von NABU und BUND und behaupteten bar jeder besseren Kenntnis,
das sei unsinnig. Es gibt eine BUND-Broschüre "Vögel im Winter", die
wir in unserem Buch auch mehrfach zitieren, in der steht, dass im
Grunde genommen nur die Vögel überleben, die das Glück haben, nicht an
eine Vogelfütterung zu geraten, weil sie sonst wegen des "falschen"
Futters eingehen würden. Das ist hanebüchen.
Aber stützen die sich nicht auf Studien, wenn sie so etwas sagen?
Leider nur selten. Oft sind das irgendwelche Gummistiefel-Ökologen,
die sich ihre Argumente selbst zusammenreimen. Die sagen, es sei viel
wichtiger, wieder mehr Lebensräume zu schaffen. Das wäre ja auch schön
und gut. Aber gehen Sie mal in die offene Feldflur und sagen den
Bauern, sie müssten wieder Habitate für die Vögel schaffen. Da kommen
Sie nicht einen Quadratmeter weiter. Und dies wird eher noch
schwieriger, wenn die Flächen jetzt auch noch für Bioenergie gebraucht
werden. Zufüttern dagegen kann jeder, der einen Garten hat von heute
auf morgen umsetzen, und es hat viele Vorteile.
Welche denn?
Wenn Sie es richtig machen und ausdauernd über mehrere Jahre,
erreichen Sie damit nicht wie oft behauptet nur eine Handvoll, sondern
50, 70 und mehr Vogelarten. In England sind es weit über 150 Arten, die
da kommen.
Die kommen alle in meinen Garten?
Das kommt drauf an, wo er ist. Im Zentrum von Berlin sicherlich
nicht, aber wenn Sie am Ortsrand eines Dorfes wohnen, wo es in der Nähe
genügend Lebensräume für die Vögel gibt, kommen sogar auch der
Kleinspecht, der Mittelspecht, gelegentlich auch die Dorngrasmücke
vorbei. Sie können Populationen stabilisieren und sogar wieder neu
aufbauen - wenn zum Beispiel in ihrer Gemeinde die Haus- oder
Feldsperlinge weitgehend ausgestorben sind, können Sie die mit
Nistkästen und Fütterung wiederansiedeln. In England ist das zum
Beispiel mit Stieglitzen wunderbar gelungen.
Können Sie mal erklären, warum die Vögel überhaupt Zufütterung brauchen?
Ganz einfach: Sie finden in der modernen Kulturlandschaft kaum mehr
Futter. Allein in Deutschland waren bis in die 50er Jahre in der freien
Feldflur mindestens eine Million Tonnen Samen von Wildkräutern für die
Vögel verfügbar. Kartoffel, Weizen- und Rübenfelder waren damals
dermaßen mit "Unkräutern" zugewachsen, dass man die eigentlichen
Nutzpflanzen kaum gesehen hat. Ich bin als Schüler noch mit meiner
Klasse rausgeschickt worden, um diese Äcker freizurupfen, damit die
Bauern ernten konnten. Die Unkräuter wurden dann als Ziegenfutter
hergenommen, waren also auch für die Haustiere eine wichtige Ressource.
Und für die Vögel war das natürlich ein reich gedeckter Tisch:
Kornblumen, Mohnblumen, Konraden, wilde Stiefmütterchen - Hunderte
Arten, die alle Samen produziert und dazu viele Insekten angelockt
haben. Davon lebten Rebhühner, Goldammern, Grauammern, Feldlerchen und
so weiter. Dieses Nahrungsinventar ist heute praktisch auf Null
zurückgegangen, weil die Felder auf maximalen Ertrag ausgerichtet sind.
Alles ist freigespritzt mit Herbiziden, so dass Sie heute auf
Quadratkilometern keine Korn- oder Mohnblume mehr finden.
Und Meisenknödel im Garten können das ersetzen?
Zumindest ein Stück weit. Man muss auch die Historie sehen: Wir
haben die meisten Vogelarten einst ja überhaupt erst durch die
Landwirtschaft in unsere Landschaft gelockt. Im Mittelalter gab es da
fast nur Buchenwälder mit lediglich rund 50 Vogelarten. Das waren im
Wesentlichen Auerhuhn, Waldkauz. Meisen, Spechte. Durch das Anlegen von
Feldern, Obstgärten, Weinbergen und so weiter haben wir Vögel wie Grau-
und Goldammern erst vom Mittelmeer und aus dem Osten hergelockt. Auch
Pferdeäpfel waren für Sperlinge eine willkommene ganzjährige
Nahrungsquelle. Bei Hühnerfütterungen auf Bauernhöfen haben damals auch
Ammern und Finken mitgepickt. Im Prinzip haben wir also damals
unbewusst auch zugefüttert. Erst ab den 1960er Jahren haben wir solche
Quellen wieder gekappt, was dazu geführt hat, dass die Vögel heute
wieder verschwinden. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir die
Vogelvielfalt erhalten wollen, sollten wir wieder füttern.
Wie genau stellt man das heute als Gartenbesitzer am besten an?
Juni, Juli, August sind gute Monate, anzufangen. Dann können die
Vögel sich mit der neuen Quelle vertraut machen, bis im Winter das
Futter in der Natur noch knapper wird. Man sollte Nistkästen aufhängen
und dann einfaches Grundfutter ausstreuen sowie Meisenknödel anbieten.
Man muss beim Kauf nicht einmal darauf achten - die Futterpackungen
enthalten immer die jahreszeitlich richtigen Körner: im Sommer eher
kleine Körner und Flocken, die leicht zu bearbeiten sind und auch
Jungvögel essen können, im Winter mehr große Sonnenblumenkerne. In den
Meisenknödeln steckt zudem viel Fett. Das gibt den Vögeln speziell im
Sommer, wenn sie bei der immer schwieriger werdenden Futtersuche für
die Jungen weit fliegen, die nötige Energie.
Was ist mit Trinkwasser?
Sollte man immer anbieten - auch im Winter. Es wird zwar oft
behauptet, den Vögeln könnte das Gefieder einfrieren, wenn sie in der
Vogeltränke baden, aber das ist Unsinn. Das Wasser perlt an ihrem
Gefieder ab. Im Winter brauchen Vögel zum Verdauen der vielen trockenen
Körner mehr Wasser als im Sommer. Wenn Sie sonst keines finden, trinken
sie oft aus den Schmelzpfützen am Straßenrand, die wegen des gestreuten
Salzes seltener zufrieren. Und was Salzwasser beim Trinken anrichtet,
wissen wir ja alle.
Verlernen die Vögel nicht, selbst Futter zu suchen?
Eine sehr wichtige Frage, die genau untersucht wurde. Es hat sich
gezeigt, dass die Vögel unser Angebot als das nutzen, was es ist: ein
Zufutter. Das heißt, sie nehmen es nur, wenn sie in der Natur nicht
genug finden. Denn dort hat das Futter eine bessere Qualität.
Aber fördert man nicht sehr einseitig die Körnerfresser, und die
Insektenfresser bleiben auf der Strecke?
Nein, die meisten Insektenfresser nehmen auch gern Körner. Sowieso
sind fast alle unsere heimischen Vögel Gemischtköstler mit leicht
verschiedenen Vorlieben. Ein Gimpel etwa frisst mehr Körner als eine
Gartengrasmücke oder eine Nachtigall. Aber die Nachtigall nimmt auch
Körner, wenn sie weich sind. Und an das Fett im Meisenknödel gehen alle
dran, sogar Fitislaubsänger, Winter- und Sommergoldhähnchen. Und wenn
sie mit ihren zarten Schnäbelchen die Körner selbst nicht aus dem Netz
rausholen können, warten sie, bis sich ein Specht oder ein Grünling
dranhängt und dort ordentlich spachtelt. Da fliegen dann rechts und
links die Fetzen, und es fällt was für sie ab. Nur wenige, wie
Mauersegler, Rauch- oder Mehlschwalbe sind reine Insektenfresser. Da
können Sie machen, was Sie wollen, die kommen nicht ans Futterhaus. Und
deren Bestände nehmen entsprechend zurzeit auch besonders rapide ab.
Könnte man sie nicht indirekt fördern, etwa durch einen Teich?
Das wäre in der Tat eine große Hilfe, weil sich an so einem Teich
viele Insekten tummeln. Aber so etwas kostet natürlich einen Haufen
Geld, macht eine Heidenarbeit und erfordert einen langen Atem. Während
man die Vogelfütterung in ganz Deutschland mit wenigen Mitteln sehr
effektiv und schnell umsetzen kann.
Kann man trotzdem gezielt bestimmte Arten füttern und ist das sinnvoll?
Auf jeden Fall. Den Zaunkönig zum Beispiel. Der frisst sehr gern
Weichfutter, vor allem Mehlwürmer. Wenn man die aber offen hinstellt,
schnappen die Amseln und Stare alles weg; das können sie kaum mehr
bezahlen, so schnell geht das. Aber der Zaunkönig schlüpft gern zum
Beispiel unter Wurzeln durch, und darum kann man die Würmer unter ein
schräges Brettchen an der Hauswand in eine kleine Schale legen. Da
holen sich die Zaunkönige ihr Futter dann ab.
Besteht andererseits nicht die Gefahr, dass man durch die
Zufütterung in die Zusammensetzung der Vogelgemeinschaft eingreift,
weil einige Arten mehr davon profitieren als andere?
Wie bereits angedeutet: Die Vogelgemeinschaft, die wir zu bewahren
versuchen, ist bereits eine künstlich geschaffene. Die hat sich vor 500
Jahren so entwickelt. Die ganz ursprüngliche Zusammensetzung ist schon
seit 5000 Jahren dahin. Damals haben wir schon begonnen, die Landschaft
völlig umzukrempeln. Außerdem haben sich bei uns inzwischen durch unser
Zutun ungefähr 150 exotische Arten niedergelassen - Nandus, Flamingos,
Jagdfasane, sogar zehn Papageienarten. Durch den Klimawandel wandern
zudem viele Arten aus Afrika ein. Da ist so viel in Bewegung, dass man
die marginalen Verschiebungen durch die Fütterung getrost
vernachlässigen kann.
Einige Kritiker sagen auch, dass an Futterstellen erhöhte
Infektionsgefahr herrscht, wegen Verunreinigungen und verhältnismäßig
großem Gedränge.
Zunächst einmal muss man dazu sagen, dass Vögel eine unglaublich
gute Immunabwehr haben. Ihre Körpertemperatur liegt zwischen 43 und 45
Grad, sie leben also quasi im Dauerfieber, da schaffen es Bakterien
kaum, sich anzusiedeln. Ich habe schon Tausende Vögel operiert.
Wundinfektionen waren da nie ein Problem. Wir haben dazu auch mal eine
Studie gemacht: Wir hatten drei Arten von Futterstellen eingerichtet,
die einen wurden jeden Tag sauber gemacht, die zweite Kategorie alle
ein bis zwei Wochen und die dritte überhaupt nicht. Die Vögel, die
kamen - insgesamt rund 2000 - haben wir beringt und regelmäßig auf
Infektionen untersucht. Ergebnis: kein Unterschied. Man kann die Tiere
also im Grunde genommen im größten Dreck füttern, das macht ihnen
nichts. Ist ja auch kaum verwunderlich: Stellen Sie sich ein Dorf vor
zweihundert Jahren vor: ungeteerte Straßen, in denen sich der ganze
Dreck gesammelt hat, Pferdeäpfel, die Abwässer der Höfe, Hunde koteten
dort rein - das war eine unvorstellbare "Granatensauerei". Alte
Beschreibungen sagen uns: Diese Dörfer hat man gerochen lange bevor man
sie gesehen hat. Die Einwohner rochen genauso schlecht, und viele
überlebten den Dreck auch nicht. Aber die Sperlinge und Rotschwänze und
Stare sehr wohl, deren Bestände waren damals so groß wie nie. Bis in
die 50er Jahre hat man die Spatzen an ihren Schlafplätzen sogar mit
Dynamit in die Luft gesprengt, weil man befürchtete, die fressen die
Felder leer.
Inwieweit ist Vogelfütterung sinnvoll, wenn ich in einem Hochhaus
mit Balkon in der Stadt wohne?
Da wird es schwierig. Im sechsten oder siebten Stock können sie
kaum mit Vögeln an der Futterstelle rechnen, selbst wenn sie teuerste
Bioprodukte anbieten. Kleinvögel entfernen sich in der Regel ungern
allzu weit von der Vegetation am Boden. Im ersten oder zweiten Stock
kann man Besuch von bis zu 100 Individuen aus rund zehn Vogelarten
bekommen. Bei mir zu Hause in einer kleinen Landgemeinde mit vielen
Gebüschen und Bäumen haben wir eine Futterstelle hinterm Haus, eine an
einem Schafstall und eine weit draußen im Wald. Dort haben wir pro Tag
zwischen 500 und 2000 Besucher aus mindestens 30 Arten.
Man hat also auf dem Land mehr Vielfalt als in der Stadt?
Es kommt darauf an. Wenn Sie in einem sehr grünen Stadtbezirk
wohnen, kann dort womöglich die Vogeldichte höher sein als in einem
dieser idyllischen bayerischen Dörfern mit Geranienbalkons, wo aber
rundherum nur ausgeräumte Feldfluren mit reinem Zuckerrübenanbau
vorwiegen. Wenn Sie in solchen Dörfern Fütterungen machen, kommt fast
kein Vogel, weil da keiner mehr brüten kann. Ein Minimum an Habitat
muss schon da sein in der Umgebung.
Kann man auch seinen Garten dazu machen?
Ja, dazu braucht man reichhaltige Strukturen: ein paar Bäume, viele
Sträucher, wo sich die Vögel drin verstecken können und Futterpflanzen
wie Kletterrose, Clematis und Wegwarte. Wenn man da Fettknödel
aufhängt, kommt meist binnen einer Stunde die erste Meise.
Wie findet die das so schnell? Woher weiß die von meinem Fettknödel?
Meisen sind sehr neugierig, schauen sich stets um, prüfen alles und
jedes in jeder Richtung. Und wenn die ungefähr einen Meter an einen
Meisenknödel herankommen, riechen sie ihn. Ihr Geruchsvermögen ist
ähnlich gut wie das des Menschen.
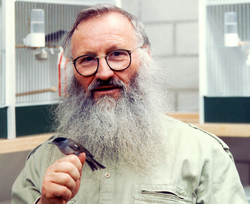
Der Ornithologe Prof. Peter Berthold war bis 2005 Leiter der Vogelwarte Radolfzell.
BUCHTIPP: Peter Berthold, Gabriele Mohr: Vögel füttern - aber richtig. Kosmos.
96 Seiten, 7,95 Euro.
|